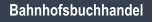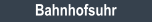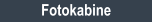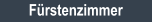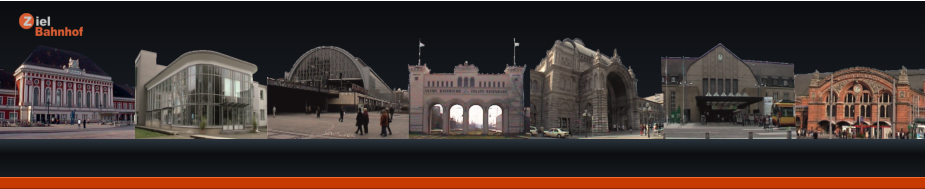
EINE DOKUMENTATION
Mit Aufkommen der Eisenbahn auf großen Bahnhöfen nutzten
„Bücherjungen“ die langen Aufenthalte der Züge, um den Reisenden
Lektüre anzubieten. 1860 konnten die Reisenden vom Verkaufswagen
Zeitungen und Bücher kaufen. Es gab damals sogenannte
Reisebibliotheken. Das waren spezielle Buchreihen mit großer Schrift, die
beim Ruckeln des Zuges besser lesbar waren. Die Geschichten wurden
den Fahrzeiten der Züge angepasst. Es wurde nicht angenommen, dass
der Käufer sich bei der nächsten Reise das Buch wieder mitbrachte.
Schon sehr früh begann das Bahnpersonal Zeitungen sporadisch auf eigene
Rechnung an Reisende zu verkaufen. Anfangs wurde dies durch die
Bahnverwaltungen geduldet. Später übernahmen die Verwaltungen die
Verpachtung der Buchhandlungen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Erstmals wurde 1852 der Buchhandel vom Pariser Verlagshaus Hachette auf den Pariser Bahnhöfen eingeführt. Bald darauf
folgte in England die Firma W. L. Smith & Son, die weit über 1000 Vertriebsstellen verfügte. Später folgte in Deutschland die
Berliner Firma Georg Stilke.
In Deutschland wurden die Bahnhofsbuchhandlungen
konzessioniert und von den Bahnverwaltungen
beaufsichtigt. Bücher mit unsittlichem oder anstößigem
Inhalt waren nicht erlaubt. Der Preis der Bücher entsprach
den landesüblichen Ladenpreisen. Die Öffnungszeiten
richteten sich nach den An- und Abfahrtzeiten des
Eisenbahnverkehrs.
Heute frequentieren ca. 1,2 Millionen Kunden in jeder
Woche die 460 Bahnhofsbuchhandlungen, die zu fast 90 %
großen Verkaufsketten gehören.
Der Ansichtskarte kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.
Die Ansichtskarte gab es in Deutschland schon seit 1870. Der Durchbruch
erfolgte aber erst 1896. Diese Bildpostkarten gab es im
Bahnhofsbuchhandel oder dem Bahnhofsrestaurant. Die Bahnhofswirte
waren häufig die Auftragsgeber für der Druck einer Bildpostkarte. Wie
im Bild links für den „Gasthof zur Station Hochdahl“ zu sehen. In großen
Städten gab es sogar Ansichtskartenautomaten. Fotopostkarten und
Lithografien mit Bahnhofsmotiven gab es von „jedem Dorfbahnhof”. Die
meisten wurden zwischen 1895 und 1900 sowie 1940 und 1945 gedruckt.
Einen kleinen Aufschwung erlebte die Ansichtskarte in den 1950/1960er
Jahren. Heute sind sie Zeitzeugen für die ersten Abbildungen von
Empfangsgebäuden geworden.
Da die Auflage einer Ansichtskarte je nach Bahnhof aufgrund der Kosten
verhältnismäßig hoch sein mussten, unterscheidet sich der
Aufnahmezeitpunkt vom Versanddatum oft erheblich. So kann die Aufnahme beispielsweise 1910 entstanden sein, aber der
Versand, durch Poststempel beurkundet, erfolgte erst 1920. Es gibt also immer eine mehr oder weniger große Differenz. Bei
kleinen Bahnhöfen wurde oft nur eine Auflage hergestellt. Der Abverkauf dauerte dann manchmal zehn oder mehr Jahre.
Um den ungefähren Aufnahmezeitpunkt, festzulegen hier einige Regeln:
•
Handelt es sich bei der Ansichtskarte um eine Lithografie oder um ein Foto ?
•
Passt der Baustil oder die Anbauten zum Jahr des Poststempels ?
•
Zeigt die Abbildung die Orts- oder die Gleisseite ?
•
Ist der Hausbahnsteig oder der Inselbahnsteig überdacht ?
•
Gab es ein Vorgänger-Gebäude oder ein Nachfolge-Gebäude, wann erfolgten die Umbauten ?
•
Ist die Toilettenanlage zu sehen ?
•
Sind auf der Ansichtskarte Personen zu sehen und wie sind diese gekleidet ?
•
Zeigt das Motiv elektrische Lampen, Pferdedroschken oder Automobile ?
•
Welche Signalanlagen sind zu sehen ?
•
Passt die Lokomotive oder die Uniform des Bahnpersonals zum Poststempel ?
Buch- und Zeitungsverkauf im Bahnhof
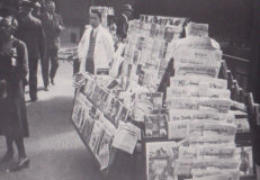


Bahnhofsbuchhandel